Sind Koalitionen schlecht? Oder anders gefragt: Wie kommen wir zu guten Entscheidungen?
Politischer Blog Darmstadt: Was ich gelernt habe, als ich’s gemacht habe – Kommunalpolitik von und mit Ana Lena Herrling – 10.10.2025 : Vol 1
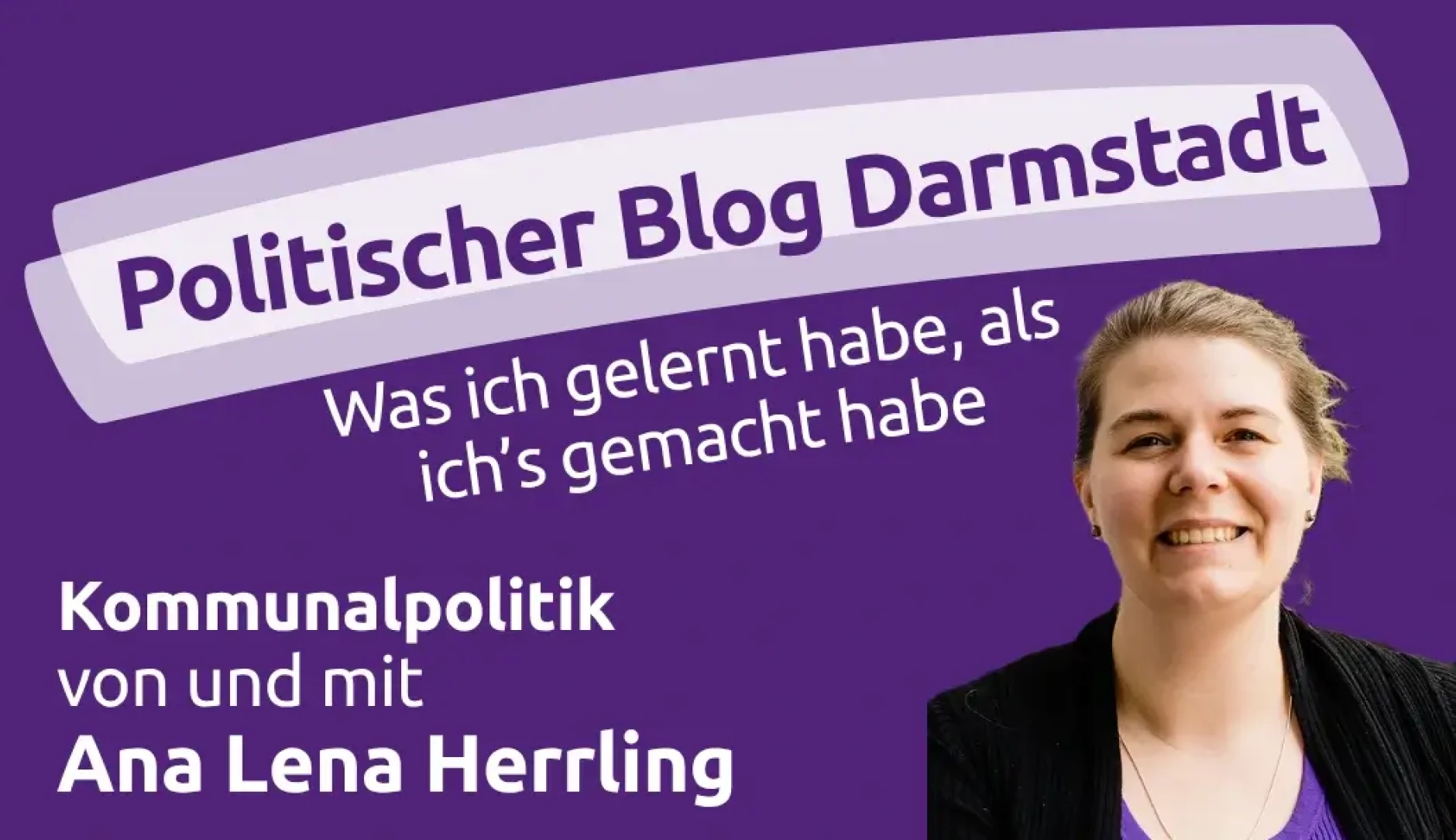
Ich war letztens auf einem Mandatsträger:innen-Treffen von Volt Deutschland. Ein tolles Workshop-Wochenende mit 50 Menschen aus ganz Deutschland, alle aktiv in kommunalen Parlamenten, die meisten noch relativ neu im Amt. Wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht als Quereinsteiger:innen in kommunalen Parlamenten. Manche Parlamente sind sehr groß – Darmstadt hat 71 Personen und Frankfurt am Main 93 – und manche sind klein – der Ortsbeirat Darmstadt Wixhausen hat 9 Personen.
Eine Sache war besonders spannend: In politischen Fragen waren wir uns schnell einig und die Volt-Vision war klar – aber in der Frage, wie Zusammenarbeit und die Entscheidungsfindung im Parlament funktioniert, hatte jede:r eigene Erfahrungen gemacht.
Für jede:n von uns sah „Normalität“ anders aus. Wir wurden in bestehende Systeme geworfen – mit ihren eigenen Regeln, unausgesprochenen Erwartungen und sozialen Gefügen. Man übernimmt ein Mandat – und steht mittendrin: zwischen politischen Traditionen, kommunalen Gepflogenheiten, Verwaltungslogik, der ganz eigenen Dynamik der Stadt und dem menschlichen Faktor.
Und über allem schwebt die Regierungsform: Koalition, wechselnde Mehrheiten, irgendetwas dazwischen. Ich musste erst einmal verstehen, wie der Laden läuft. Das alles steht in keinem Handbuch – und leider auch in keinem Koalitionsvertrag. Auch nicht in unserem. Für mich war eine der ersten Fragen:
Wie und wo werden wichtige Gespräche und Diskussionen geführt?
Wo und in welchem Umfang werden Diskussionen geführt – in Vorgesprächen hinter verschlossenen Türen, in Ausschüssen, in der großen Parlamentssitzung, oder eher informell in privaten Sitzungen?
Manche Mandatstragende von Volt haben wöchentlich Austausch auch mit den anderen Parteien. Andere sprechen maximal einmal im Monat über politische Themen und das nur in öffentlichen Sitzungen.
Bei uns in Darmstadt werden die Ausschüsse nur bedingt genutzt, um Diskussionen zwischen den Fraktionen auszutragen. Die meisten wortreichen Auseinandersetzungen entstehen öffentlich in der großen Parlamentssitzung. Diese dauert dann gut und gerne acht Stunden.
In Mainz zum Beispiel wird in den Ausschüssen viel mehr diskutiert, wodurch die Parlamentssitzung dann mehrheitlich nur zum Abstimmen verwendet wird – und nur zwei Stunden dauern kann. Ich finde das einen guten Ansatz. So wird dort diskutiert, wo auch wirklich Zeit dafür ist.
Mit wem finde ich Lösungen und treffe gemeinsam Entscheidungen?
Für manche ist es ganz normal, themenbezogen mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten oder sogar für jeden einzelnen Antrag neue Verbündete zu suchen – also mit wechselnden Mehrheiten, je nach Thema und Vorlaufzeit mit unterschiedlichen Fraktionen – mal mit kleinen, mal mit großen, mal mit vielen.
Für mich ist es Alltag, in einer festen Koalition zu arbeiten und mit diesen Fraktionen sehr eng zu arbeiten. Beide Systeme haben ihre ganz eigenen Dynamiken sowie Vor- und Nachteile.
Ich erlebe Koalitionsarbeit als kraftvoll. Wir können strategisch planen, Ziele langfristig – naja, über mindestens 5 Jahre hinweg – verfolgen. Und ja, man genießt den Vorteil einer stabilen Mehrheit. Wir können auch wichtige Entscheidungen schnell treffen, wenn nötig. Z.B. wenn es um Infrastrukturprojekte geht, wie die schnelle Neuplanung einer Brücke, den Ausbau von Radwegen oder Finanzthemen wie die Umplanung des Mittelfristigen Investitionsplans der Stadt innerhalb von zwei Monaten.
Was ich daran auch schätze: Es fühlt sich jemand verantwortlich. Ich habe es schon erlebt, dass in einem Ausschuss fast nur die Koalitionsparteien erschienen sind. Ohne sie wäre die Sitzung nicht beschlussfähig gewesen. In solchen Momenten wird spürbar: Koalitionen geben Richtung und auch Verlässlichkeit.
Darüber hinaus können Koalitionen einen Beitrag dazu leisten, extreme politische Positionen zu entschärfen. Denn Koalitionsparteien sind gezwungen, Kompromisse einzugehen, gemeinsame Ziele zu formulieren, Verantwortung zu teilen – statt zu polarisieren oder sich vielleicht auch in Provokationen zu verlieren. Koalitionen ermöglichen es, Prinzipien gemeinsam abzusichern – auch unter Druck. In Karlsruhe zum Beispiel gibt es die Abmachung zwischen den demokratischen Parteien, dass keine Entscheidung gefällt wird, wenn sie nur durch die Stimmen der AfD möglich wäre. Das ist nicht einfach – aber wichtig. Das beeinflusst dann das Abstimmverhalten der demokratischen Parteien.
Aber wir müssen ehrlich sein: Das klassische Modell der Koalition ist in letzter Zeit auch sichtbar an Grenzen gestoßen. Die Ampel auf Bundesebene ist zum Sinnbild für gegenseitige Blockade geworden. Und auch auf kommunaler Ebene gibt es Beispiele – wie jüngst in Frankfurt, wo eine Koalition nach vier Jahren aufgelöst wurde. Ich habe Martin Huber, Fraktionsvorsitzender von Volt Frankfurt, nach seiner Perspektive gefragt, und was er von wechselnden Mehrheiten hält. Seine Antwort: “Eine Koalition kann theoretisch sehr effektiv Politik machen, aber das hängt letztendlich an der Bereitschaft jedes einzelnen Koalitionspartners, auch Kompromisse schließen zu wollen. In Frankfurt war das zuletzt leider nicht mehr der Fall, viele Entscheidungen haben zu lange gedauert oder wurden von der FDP blockiert, letztlich ist das Bündnis daran zerbrochen. Nun arbeiten wir für den Rest der Wahlperiode weiterhin mit den Grünen und der SPD als Koalition ohne eigene Mehrheit zusammen. Das heißt, wir brauchen weitere Stimmen aus der Stadtverordnetenversammlung, um Vorhaben verabschieden zu können. In meinem ersten Fachausschuss hat das erstmals unter den neuen Bedingungen tatsächlich gut funktioniert, wir haben Vorhaben in insgesamt drei unterschiedlichen Konstellationen verabschiedet. Mein Gefühl ist, mit wechselnden Mehrheiten kommt es schneller zu klaren Entscheidungen, zum einen, weil es keine Koalitionsmehrheit mehr gibt, die sich selbst blockieren kann, zum anderen, weil praktisch alle Fraktionen in der Verantwortung stehen, auch Entscheidungen herbeizuführen. Außerdem werden die Diskussionen ehrlicher und sie gewinnen an Bedeutung, wenn sie tatsächlich dazu dienen, argumentative Überzeugungsarbeit zu leisten. Nur beim Haushalt für das Jahr 2026 zeichnen sich derzeit schwierige Diskussionen ab, es ist nun völlig unklar, ob es bis zur nächsten Kommunalwahl inmitten des Wahlkampfes dafür noch eine Mehrheit gibt. Für mich ist es also noch zu früh, um ein finales Fazit zu ziehen. Der Erfolg beider Modelle, ob Koalition oder wechselnde Mehrheiten, ist auch stark abhängig von den einzelnen Akteuren und der politischen Kultur insgesamt.”
Wechselnde Mehrheiten
Durch die Gespräche beim Mandatsträger:innen-Treffen habe ich auch verstanden, warum viele Kolleg:innen die Arbeit mit wechselnden Mehrheiten schätzen. Dort fühlt sich jede:r verantwortlich, ein neues Thema zu starten und Gleichgesinnte zu finden. Die Diskussionen sind oft offener und der Zwang zur ständigen Verhandlung treibt die Politik an. Auch die Dezernent:innen und Bürgermeister:innen müssen in diesem System im sehr engen Austausch mit allen Fraktionen sein. Das ist viel Arbeit und belastet auch den Alltag, bringt aber eine andere Art der Transparenz. Das ist förderlich für das Vertrauen in die Politik!
Als größte Herausforderung dieser Form sehe ich, die strategische Linie halten zu können und mehrere Entscheidungen auf der Basis eines Ziels durchsetzen zu können. Und das über Jahre. Die konstante Suche nach Verbündeten und gemeinsamen Kompromissen kann dazu führen, dass Inhalte verwässert werden und sich Prozesse unnötig in die Länge ziehen.
Auch die Haushaltsplanung wird wohl öfter zur Geduldsprobe. In großen Runden fällt es schwer, sich auf einen klaren, finanzierbaren Haushalt zu einigen. Jede Fraktion möchte noch „ihr“ wichtiges Thema unterbringen – nachvollziehbar, aber nicht immer realistisch. Am Ende wird der ursprünglich geplante Betrag überschritten, weil niemand den letzten Punkt von der Liste streichen will.
Welches System ist demokratischer?
Diese Frage kam auch bei unserem letzten Volt-Mandatsträger:innentreffen auf – und sie hat mich nicht losgelassen.
Meiner Meinung nach sind alle Regierungsformen, die aus einem gewählten Parlament entstehen, demokratisch. Die Parlamente sind gewählt, die Zusammensetzung legitim. Die Entscheidungen werden – ob in Koalitionen oder im offenen Aushandlungsprozess – am Ende immer durch Mehrheiten getroffen.
Die Frage ist also nicht nur, ob es demokratisch ist. Sondern wie sich Demokratie im Alltag bei den Bürger:innen und den Parlamentarier:innen anfühlt. Also ob man sich als Teil der Entscheidungen erlebt – oder als jemand, der nur noch abnickt. Oder ob Argumente überhaupt etwas bewegen können – auch wenn man nicht in der Mehrheit ist. Wenn Prozesse nicht nur korrekt, sondern auch nachvollziehbar und offen sind.
Demokratie ist nicht nur ein Verfahren – sie ist auch ein Gefühl. Und wie dieses Gefühl entsteht, hängt stark davon ab, wie wir miteinander Politik machen.
Fazit
Vielleicht ist die eigentliche Frage nicht, welches System das beste ist – sondern: Wie schaffen wir es, das Beste aus jedem System herauszuholen?
Ich bin der Meinung, dass der Schlüssel im menschlichen Handeln liegt – unabhängig von Koalitionsvertrag oder Sitzverteilung. Dafür müssen wir uns austauschen und voneinander lernen.
Die Art und Weise von Politik muss im wechselnden System mehr abgestimmt und durch mehr Argumentenaustausch zwischen den Mandatstragenden erfolgen. Das finde ich gut und wichtig! Aber es heißt ja nicht, dass das in einem Parlament mit Koalitionsregierung nicht auch machbar ist!
Im November ist das nächste europäische Mandatstragenden-Treffen – mal sehen, welches Thema dort aufkommt.